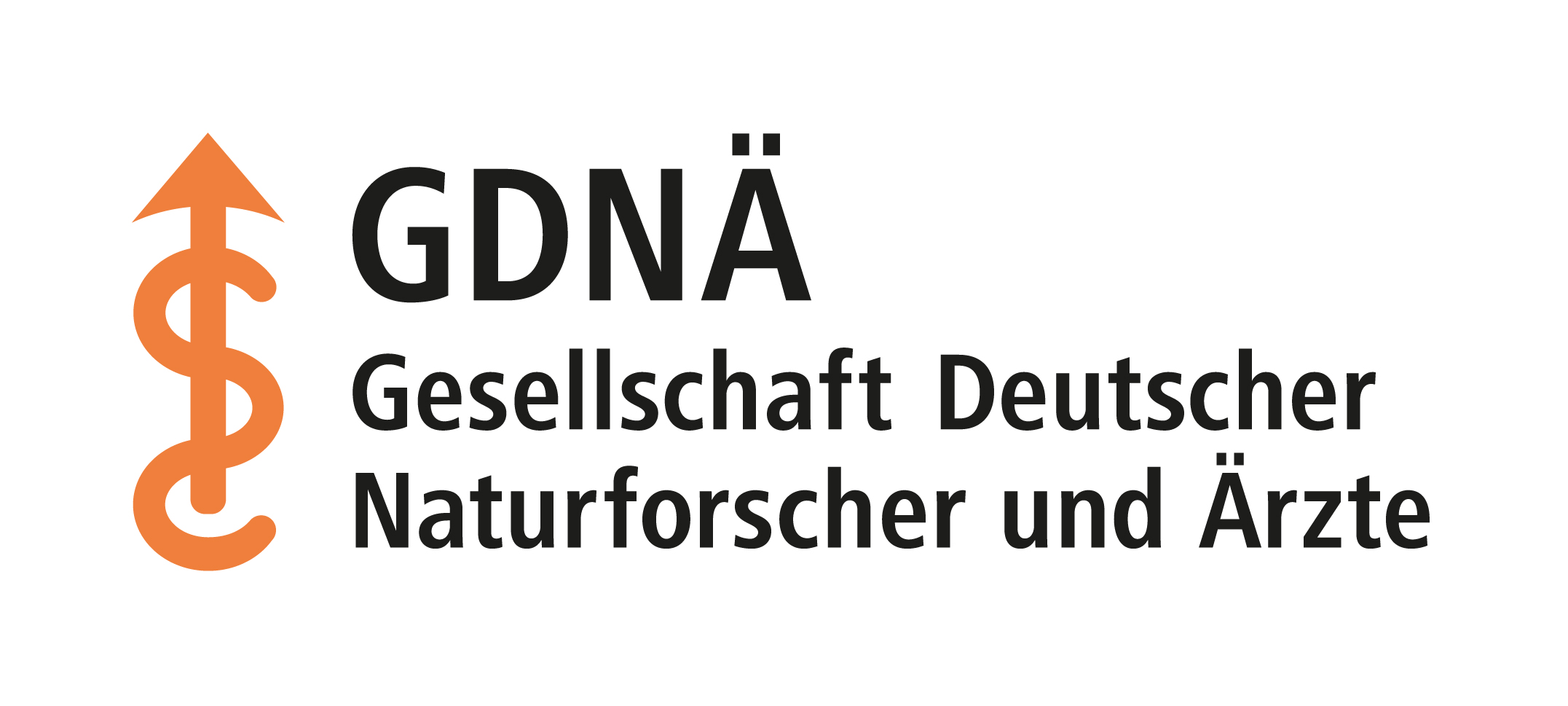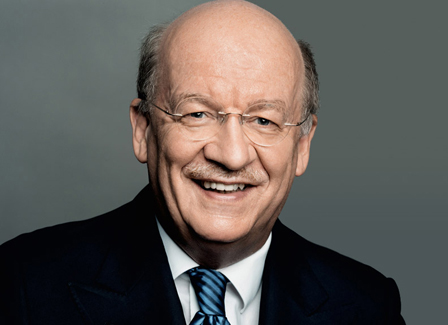Michael Tausch, Innovationsforscher an der Universität Wuppertal, über das gewaltige Potenzial der Sonnenenergie, veraltete Lehrpläne und sein Werben für die Chemie des Lichts
Herr Professor Tausch, woran arbeiten Sie gerade?
Ich erstelle derzeit Materialienpakete für den Chemieunterricht. Damit will ich Lehrern helfen, auch im Homeschooling lebendigen, gehaltvollen und zeitgemäßen Unterricht zu gestalten.
Wie können wir uns so ein Materialienpaket vorstellen?
Aktuell geht es um das Thema Licht – Farbe – Energie. Dazu stelle ich digitale Lernpfade aus Texten und Videos von Experimenten zusammen, wobei ich aus einem großen Fundus schöpfen kann. Vieles entnehme ich der allgemein zugänglichen Website „Chemie mit Licht“ meiner Arbeitsgruppe an der Universität Wuppertal, anderes aus meinen eigenen Veröffentlichungen zur Chemiedidaktik. Sobald wieder reale Experimente im Präsenzunterricht möglich sind, sollten die aufgezeichneten Versuche real durchgeführt werden – das ist die Idee.
Wie kommt Ihr Paket zu den Lehrern?
Sobald es fertig ist, schicke ich es an die verschiedenen Landesbildungsserver. Dort werden die Materialien integriert und den Schulen kostenlos zur Verfügung gestellt. Das kann recht problemlos laufen, wie die Erfahrungen mit früheren Lieferungen zeigen.
Warten die Lehrkräfte schon ungeduldig auf Ihr Materialienpaket?
Einige vielleicht schon (lacht). Das sind dann diejenigen, die uns kennen und unsere Materialien mit Gewinn im Unterricht einsetzen. Andere reagieren womöglich noch zurückhaltend auf das Angebot.
Woran liegt das?
Die Chemie mit Licht, fachsprachlich: Photochemie, ist noch nicht in den Lehrplänen angekommen – sie ist also kein Pflichtstoff. Auch im Studium hatten die meisten heutigen Lehrkräfte keine Berührung mit der Thematik. Manche schrecken davor zurück, weil sie die Materie für schwierig halten und glauben, man brauche teure Apparate und giftige Reagenzien für den Unterricht.
Ein Irrglaube?
Ja. Die Chemie mit Licht lässt sich mit ganz einfachen, harmlosen und kostengünstigen Chemikalien und Geräten vermitteln – nicht nur in den Sekundarstufen I und II, sondern teilweise auch schon im Kindergarten. Da gibt es wunderschöne, aussagekräftige Versuche mit Sonnenlicht, Flaschen und LED-Taschenlampen. Details finden sich auf der erwähnten Website „Chemie mit Licht“ und im gleichnamigen Lehrbuch, das sich an Studierende des Lehramts, Lehrkräfte und interessierte Laien richtet. In unseren Fortbildungsveranstaltungen kommt es übrigens regelmäßig zu Aha-Erlebnissen: Viele Lehrer erkennen dann, wie leicht die Photochemie sich in die bestehenden Curricula integrieren lässt – nicht nur im Chemie-Unterricht, sondern auch in anderen naturwissenschaftlichen Fächern.