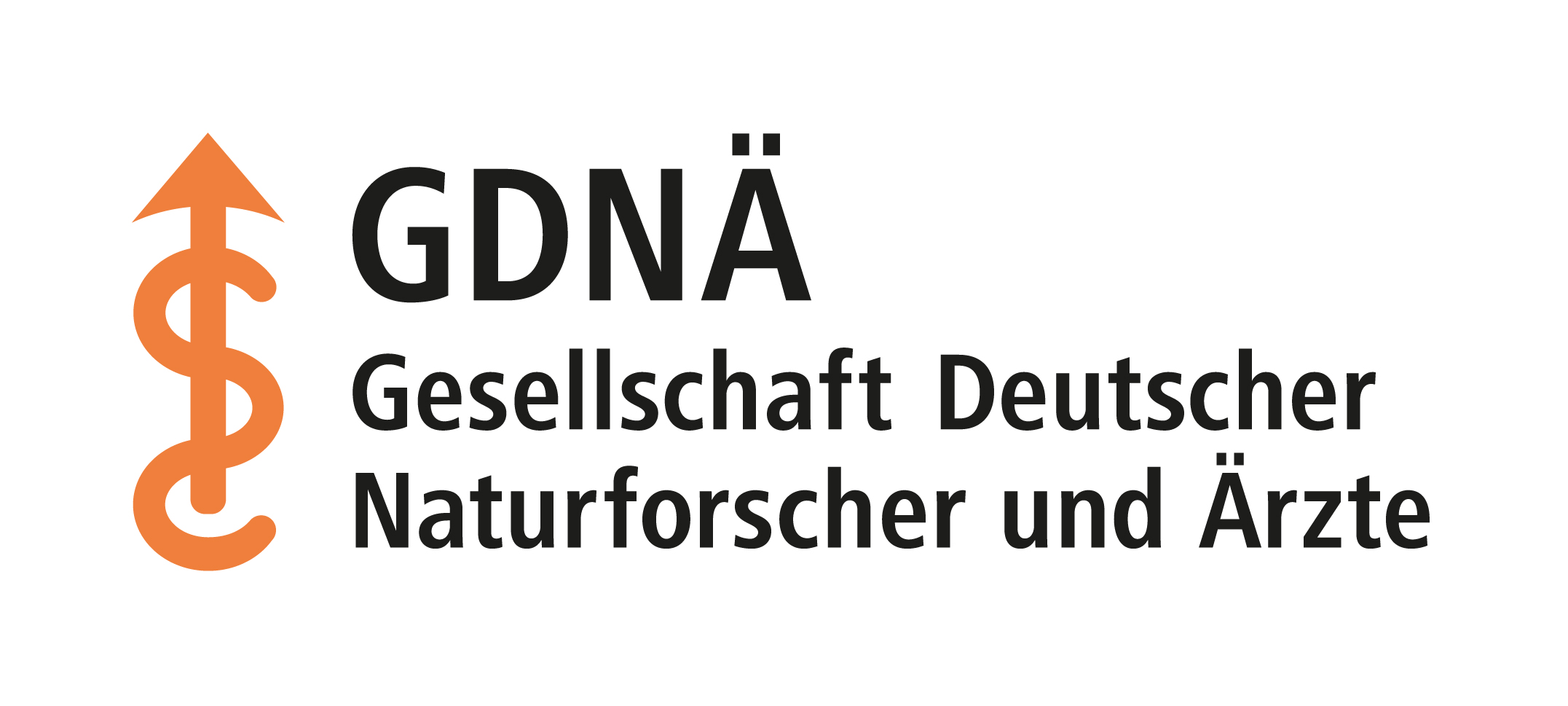Wechsel im Präsidentenamt
Wechsel im Präsidentenamt
Blick zurück, Blick nach vorn
Liebe Mitglieder der GDNÄ,
mit diesem Jahr endet meine Amtszeit als Präsident der GDNÄ. Die Corona-Pandemie hat uns gezwungen, die ursprünglich für 2020 in Würzburg geplante Tagung zuerst in das Folgejahr zu verlegen und sie schließlich mit der Leipziger Jubiläumstagung im September 2022 zu fusionieren. Damit hat sich auch meine Präsidentschaft auf ungewöhnliche vier Jahre verlängert.
Das erste dieser Jahre, 2019, diente der Vorbereitung der Tagung zum Thema „Wissenschaft im Bild“, dem Gewinnen von Sprechern, dem Konzipieren eines Rahmenprogramms. Das zweite Jahr, 2020, fand praktisch nur online statt, nachdem die Bundesregierung im März den Lockdown beschlossen hatte. Auch danach waren Treffen in Gruppen zeitweise verboten oder nicht ratsam. Mit einer Expertengruppe aus GDNÄ-Mitgliedern, Landesakademien und ifo-Institut entstand im März eine Stellungnahme zum Umgang mit der Corona-Pandemie, der sich vom restriktiven Kurs der Leopoldina abhob. Die Vorschläge zu einer schrittweisen Öffnung sind vor dem Hintergrund unserer nunmehr fast zweijährigen Pandemie-Erfahrung nach wie vor interessant und aktuell. Mit dieser Stellungnahme eröffneten wir Anfang April 2020 unsere neue Website www.gdnae.de, die mit Hilfe von Nachrichten, Berichten, Porträts und Interviews für lange Zeit das wesentliche Instrument der Kommunikation wurde. Danke an alle, die hieran mitwirkten, vor allem an unsere Redakteurin Lilo Berg.
Im dritten Jahr, 2021, standen – überraschend schnell – Impfstoffe gegen das SaRS-CoV2-Virus zur Verfügung. Selbst wenn manche in der Bevölkerung (und auch in der GDNÄ) den Injektionen skeptisch gegenüberstanden, zeigt der Blick zurück ebenso wie der heutige Blick nach China, dass sie eine zentrale Rolle bei der Überwindung der Pandemie spielten. Aber der Fortschritt war zu langsam, um eine große Versammlung abhalten zu können, und so musste die für September geplante Würzburger Tagung völlig ausfallen.
Dieses Jahr, 2022, war einerseits gekennzeichnet von sehr hohen Covid-Fallzahlen bei abnehmender Erkrankungsschwere und zurückgehenden Todeszahlen. Andererseits wurde die Krise der Pandemie abgelöst von der Krise, die der Angriff auf die Ukraine verursachte. Es wurde deutlich, dass wir persönlich und als Gesellschaft nur bedingt krisenfest und resilient sind – eine Beobachtung, die uns beschäftigen sollte! Trotz dieser Situation haben wir mit Optimismus die Erstellung der Festschrift Wenn der Funke überspringt und die Planung der Jubiläumstagung betrieben und wurden bei beidem reich belohnt! Schauen Sie doch noch einmal zurück: „Festschrift zum GDNÄ-Jubiläum“ und „200 Jahre GDNÄ – Rückblick auf die Jubiläumsversammlung 2022″
Ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, beides betreiben zu dürfen, und ich danke allen, die all das möglich gemacht haben: den vielen hervorragenden Sprechern, die Einblicke in ihre Forschung gaben, den Dozenten, die das Schülerprogramm auf einen guten Weg brachten, dem Vorstandsrat und den Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle sowie dem Team um unseren lokalen Partner Jörg Junhold vom Leipziger Zoo. Mein Dank gilt auch allen, die an der Festschrift mitgewirkt haben, den Autorinnen und Autoren, Lilo Berg für die Redaktion und Thomas Liebscher vom Passage-Verlag für die Gestaltung. Ohne finanzielle Unterstützung wären Tagung, Schülerprogramm und Festschrift nicht möglich gewesen: Hierfür danke ich der Wilhelm- und Else-Heraeus-Stiftung, der Bayer-Stiftung, der AKB-Stiftung und der Klaus Tschira Stiftung.

© MIKA-fotografie | Berlin
Der Pharmakologe Professor Martin Lohse war GDNÄ-Präsident von 2019 bis 2022. Er wechselte am 1. Januar 2023 in das Amt des 1. Vizepräsidenten.
Jetzt geht der Blick nach vorn. In der Mitgliederversammlung in Leipzig wurde Anke Kaysser-Pyzalla, die Vorstandsvorsitzende des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), in das Amt der 2. Vizepräsidentin gewählt; 2025 wird sie die Präsidentschaft übernehmen. Satzungsgemäß wird Heribert Hofer, Direktor des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) in Berlin, im Januar das Amt des Präsidenten 2023/24 übernehmen. Beide möchte ich in ihren neuen Funktionen begrüßen und ihnen alles Gute für ihre Aufgaben wünschen. Michael Dröscher wird weiterhin als Schatzmeister und Generalsekretär fungieren; ich selbst werde die Rolle des 1. Vizepräsidenten übernehmen.
Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal die Wahl der Fachvertreter elektronisch durchgeführt. Gewählt wurden Marion Merklein (Erlangen-Nürnberg) für die Ingenieurwissenschaften, Uwe Hartmann (Saarbrücken) für Physik/Geologie und Peter Liggesmeyer (Kaiserslautern) für Mathematik/Informatik. Alle, die sich in der GDNÄ neu engagieren werden, heiße ich herzlich willkommen.
Es ist viel zu tun, um die nächste Versammlung 2024 in Potsdam vorzubereiten und die GDNÄ zukunftsfest zu machen. Bewährt hat sich die Einbindung junger Menschen, vor allem im Rahmen des Schülerprogramms. Und wie zuletzt bei der Verleihung der Lorenz-Oken-Medaille an Mai Thi Nguyen-Kim im Oktober angekündigt, wollen wir den Dialog mit der Gesellschaft weiter ausbauen.
Ich habe die GDNÄ als vitale Gesellschaft mit vielen tatkräftigen Mitgliedern erlebt und bin dankbar dafür, dass ich sie auf dem Weg in ihr drittes Jahrhundert begleiten durfte. Es war eine reiche Zeit!
Ich grüße Sie in herzlicher Verbundenheit und wünsche Ihnen und den Ihren alles Gute für das neue Jahr.
Ihr
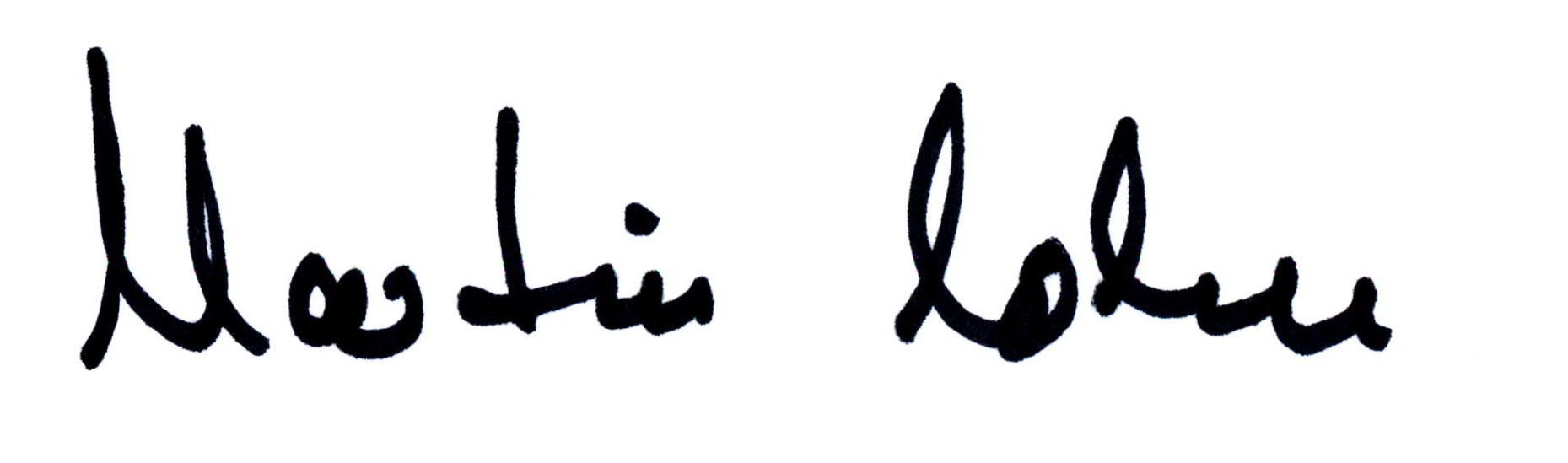
Martin Lohse, Präsident der GDNÄ

© MIKA-fotografie | Berlin
Der Zoologe Professor Heribert Hofer war Vizepräsident von 2021 bis 2022. Er hat die GDNÄ-Präsidentschaft am 1. Januar 2023 übernommen.

© DLR
Professorin Anke Kaysser-Pyzalla ist Ingenieurin. Sie tritt ihr Amt als 2. Vizepräsidentin der GDNÄ am 1. Januar 2023 an.