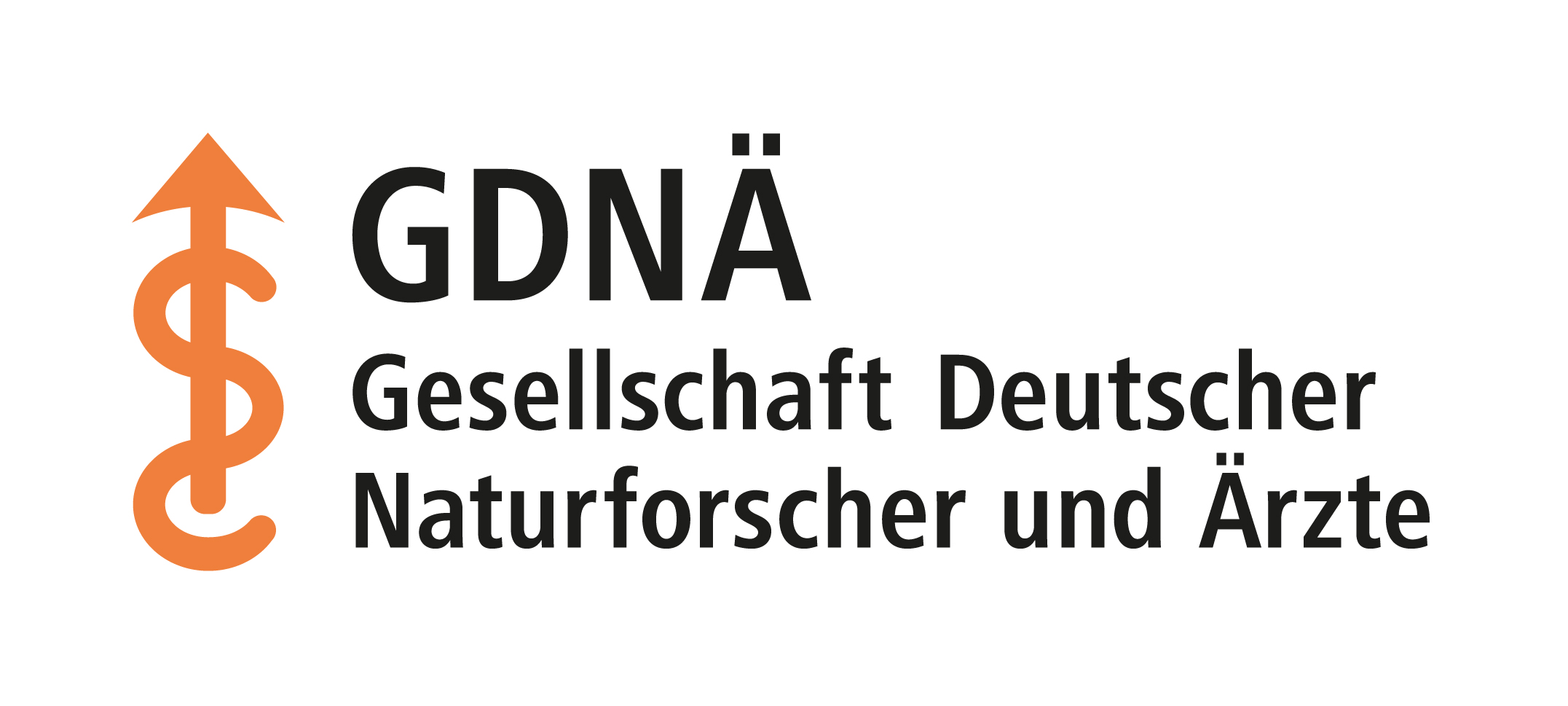Barbara Albert: Eine wichtige und großartige Aufgabe
„Eine wichtige und großartige Aufgabe“
Barbara Albert, Chemikerin und Rektorin der Universität Duisburg-Essen, über ihr erstes Amtsjahr, den Umgang mit einer Cyberattacke und Fokusthemen im Exzellenz-Wettbewerb
Frau Professorin Albert, seit April 2022 sind Sie Rektorin der Universität Duisburg-Essen, kurz: UDE. Wie war das erste Jahr im Amt?
Es war spannend und ertragreich, aber auch herausfordernd. Wir sind als Universität Duisburg-Essen Teil der Universitätsallianz Ruhr und hatten in diesem Jahr die Chance, eine neue Research Alliance aufzubauen, die unsere Forschung in eine neue Liga katapultiert. Zugleich haben wir die Bewerbungen für den Exzellenzstrategie-Wettbewerb des Bundes und der Länder energisch vorangetrieben, ebenso unsere Nachhaltigkeitsinitiative und die Gründung einer neuen Fakultät – um nur einige Beispiele zu nennen.
Mit welchem Ziel und welchen Themen tritt Ihre Universität im Exzellenzwettbewerb an?
Wir schärfen gemeinsam mit der Ruhr-Universität Bochum und der Technischen Universität Dortmund unser Forschungsprofil, zum Beispiel im Bereich der Neurowissenschaften. Traditionell ist aber auch die Trink- und Süßwasserforschung an der Universität Duisburg-Essen sehr stark. Mit dem interdisziplinären Zentrum für Wasser- und Umweltforschung, das sich schon seit zwanzig Jahren einen Namen macht, haben wir an der UDE eine international bekannte Wissenschaftseinrichtung mit Impact. Der Klimawandel erfordert einen verantwortungsbewussten und flexiblen Umgang mit der Ressource Wasser, und deswegen war es uns auch wichtig, das Thema im Exzellenzwettbewerb zu platzieren.
Am 27. November 2022, Sie waren erst gut ein halbes Jahr im Amt, gab es einen großen Cyberangriff auf Ihre Universität. Was ist damals genau passiert?
Unsere IT-Infrastruktur wurde angegriffen und Daten wurden verschlüsselt. Wir haben den Angriff an einem Sonntagmorgen entdeckt und noch am gleichen Tag die ganze Universität vom Internet trennen müssen. Mehr als drei Monate haben wir am Wiederaufbau unserer IT-Infrastruktur gearbeitet. Ein Teil unserer Daten wurde im sogenannten Darknet veröffentlicht.
Wie hat Ihre Universität auf den Anschlag reagiert?
Mit großem Einsatz aller Mitglieder und enormer Solidarität. Trotz der technischen Schwierigkeiten konnten wir für die Studierenden die Prüfungsphase Anfang Februar mit mehr als hunderttausend einzelnen Prüfungsleistungen durchziehen – das war eine großartige Leistung. Aber zugleich sind, auch jetzt noch, viele von uns sehr belastet und ausgelaugt, denn die viele unfreiwillige Extraarbeit setzt einem zu.
Bei der Bewältigung des Cyberangriffs hat die nordrhein-westfälische Landesregierung Ihre Universität finanziell unterstützt. Wie ist die Zusammenarbeit mit der Politik generell?
In der Landesregierung gibt es ein starkes Bewusstsein für den Wert von Wissenschaft. Mehr Unterstützung benötigen wir jedoch sehr dringend im Bausektor. Viele unserer Gebäude sind in den 1970er-Jahren entstanden und müssen dringend renoviert werden. Anderes wollen wir ganz neu aufbauen.

© UDE
Luftbild vom Campus Essen der Universität Duisburg-Essen.
Mit Wissenschaftsförderung verbinden Politiker oft die Hoffnung auf wirtschaftlichen Nutzen. Wie gehen Sie damit um?
Die Hoffnung ist berechtigt, denn Geld, das in Universitäten fließt, macht sich vielfach auch als wirtschaftlicher Nutzen bezahlt – besonders in der Region um eine Universität herum. Und das Ruhrgebiet ist eine Region, die zur Transformation bereit und fähig ist. Man versteht sich zu Recht als Innovationsregion. Der Startpunkt für eine Innovation ist die Invention, und woher kommt die? Vor allem aus den Universitäten. Die UDE betreibt beispielsweise seit vielen Jahren Wasserstoffforschung, die von Partnern aus der Wirtschaft stark nachgefragt ist. In meinem Rektoratsteam gibt es mit Professor Pedro José Marrón einen Prorektor für Transfer, Innovation und Digitalisierung. Er kümmert sich um den Austausch mit Partnern aus Wirtschaft und Gesellschaft und bringt die Entrepreneur-Aktivitäten, beispielsweise die Gründung von Start-ups, aus unserer Universität heraus energisch voran.
Als Chemikerin haben Sie sich mit der Entwicklung neuer Materialien beschäftigt. Bleibt Ihnen als Wissenschaftsmanagerin noch Zeit für eigene Forschung?
Ich engagiere mich im Sonderforschungsbereich 1487 „Eisen, neu gedacht!“ und betreue – am Wochenende – den Abschluss einzelner Doktorarbeiten. Für mehr reicht die Zeit leider nicht. Der Abschied von der individuellen Forschung war ein nicht einfacher, aber bewusster Schritt. Ich bin gern da, wo ich jetzt bin. Die UDE zu leiten, ist eine wichtige und großartige Aufgabe.

© UDE/Frank Preuß
Dr. Daniel Grabner, Koordinator im UDE-Sonderforschungsbereich RESIST, überprüft sogenannte Mesokosmen-Experimente. Diese bilden künstliche Mini-Ökosysteme nach und sind befüllt mit Wasser aus der Boye, einem Nebenfluss der Emscher. Dem Wasser werden verschiedene Stressoren hinzugefügt, also Faktoren, die Organismen negativ beeinflussen können.
Seit gut zehn Jahren sind Sie Mitglied der GDNÄ. Was bedeutet sie Ihnen?
Fachgesellschaften wie die GDNÄ spielen eine wichtige Rolle als Kontakt- und Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik. Durch ihre Fachlichkeit besitzen sie Glaubwürdigkeit und Neutralität. Gerade die GDNÄ ist spannend wegen der Vielfalt der Disziplinen, die sie vertritt. Das passt gut zum Anspruch von Universitäten, deren besonderer Reiz für mich darin besteht, dass wissenschaftliche Tiefe und Expertenwissen mit fachlicher Vielfalt und Breite im Anspruch institutionell verknüpft sind. Für die Zukunft der GDNÄ und für alle anderen wissenschaftlichen Gesellschaften ist es wichtig, neue Mitglieder von dem Reiz wissenschaftlicher Fachgesellschaften zu überzeugen – auch damit diese internationaler und diverser werden. Hierzu gilt es, Formate zu entwickeln, die junge Leute ansprechen und die zur heutigen Zeit passen. Ich habe die 200-Jahr-Feier in Leipzig besucht und hatte den Eindruck, dass die GDNÄ auf einem guten Weg ist.

© UDE
Professorin Barbara Albert, Rektorin der Universität Duisburg-Essen.
Zur Person
Ihre wissenschaftliche Qualifikation erwarb Barbara Albert an der Universität Bonn. Nach dem Chemiestudium wurde sie 1995 promoviert und forschte anschließend ein Jahr am Materials Research Laboratory der University of California, Santa Barbara. Im Jahr 2000 habilitierte sie sich. Im Jahr 2001 wurde Barbara Albert auf die Professur für Festkörperchemie/Materialwissenschaften an die Universität Hamburg berufen. Von dort wechselte sie 2005 an die Technische Universität Darmstadt, wo sie bis 2022 als Professorin für Anorganische Festkörper- und Strukturchemie forschte und lehrte. In den Jahren 2020 bis 2021 wirkte sie an der TU Darmstadt als Vizepräsidentin für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs. Von 2012 bis 2013 war Barbara Albert Präsidentin der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Sie ist Mitglied der Aufsichtsräte von Evonik Industries und der Schunk Group, Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und hat mehrere akademische Ehrungen erfahren. Professorin Barbara Albert wurde 2021 zur Rektorin der Universität Duisburg-Essen gewählt und trat ihr Amt am 1. April 2022 an.
Weitere Informationen: