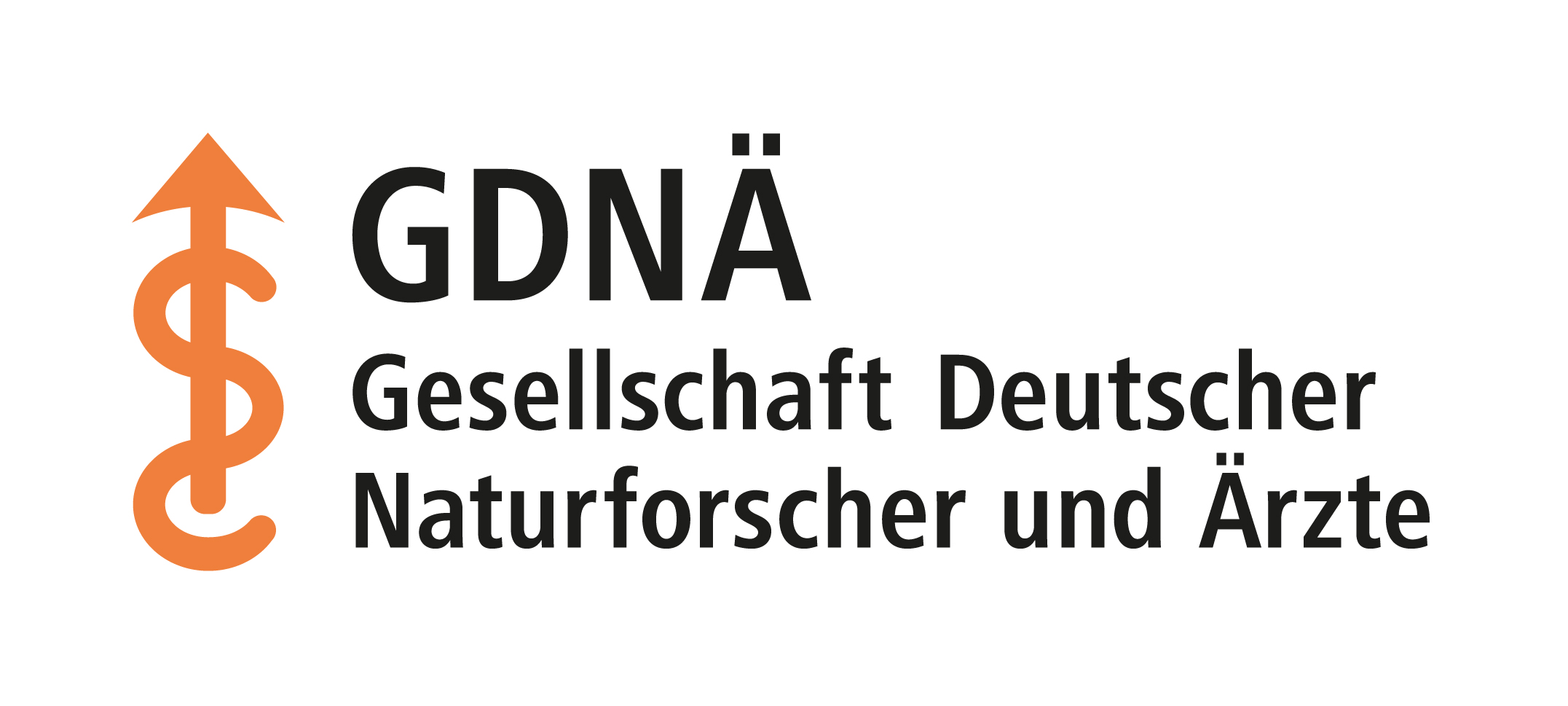„Wir sollten andere Disziplinen stärker einbeziehen“
Herr Professor Schüth, im Hauptberuf sind Sie Max-Planck-Direktor, daneben üben Sie zahlreiche Ehrenämter aus. Wissen Sie aus dem Stand, wie viele es sind?
Es sind tatsächlich viele, die genaue Zahl habe ich jetzt nicht parat. Die Ämter sind sehr unterschiedlich, auch was den Zeitaufwand angeht. Er reicht von 80 Prozent meiner Arbeitszeit in den Jahren als Vizepräsident der Max-Planck-Gesellschaft bis zur zweistündigen Sitzung alle paar Jahre in kleineren Gremien.
Vor einigen Monaten ist ein weiteres Amt dazugekommen: das des Vizepräsidenten und kommenden Präsidenten der GDNÄ. Was motiviert Sie, sich für die GDNÄ zu engagieren?
Mir gefällt ihre thematische Breite. In der GDNÄ zeigt sich, wie verschiedene Bereiche der Wissenschaft zusammenwirken – das ist in anderen Gesellschaften nicht so deutlich sichtbar. Als ich gefragt wurde, ob ich das Amt übernehme wolle, musste ich nur kurz überlegen und habe dann überzeugt ja gesagt. Die Präsidentschaft beginnt sanft mit zwei Jahren als Vizepräsident und klingt ebenso sanft wieder aus – das erleichtert vieles.

© Isabel Schiffhorst für MPI für Kohleforschung
Haupteingang des Max-Planck-Instituts für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr.
Wie wollen Sie als neues Präsidiumsmitglied vorgehen?
Zunächst werde ich mir alles genau anschauen und das, was gut läuft, unterstützen. Ein Beispiel ist die neue Nachwuchsorganisation der GDNÄ, die jGDNÄ. Dass es sie jetzt gibt, finde ich großartig und absolut zeitgemäß. Ähnliche Entwicklungen sind auch in anderen wissenschaftlichen Gesellschaften zu beobachten – ich denke etwa an die Jungchemikerforen der Gesellschaft Deutscher Chemiker, die heute praktisch jeder Ortsverband unterhält. Wichtig ist, dass die jungen Mitglieder Freiräume bekommen, in denen sie selbst etwas gestalten können.
Welche Akzente möchten Sie in Zukunft setzen?
Zunehmend interessant und wichtig erscheint mir die Wirkung der Wissenschaft auf die Gesellschaft. Was halten die Bürgerinnen und Bürger von Wissenschaft und Forschung, was haben sie davon und was können wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihnen bieten? Die GDNÄ ist meiner Ansicht nach ein gutes Forum für solche Fragen und den Austausch mit der Öffentlichkeit.
Wie kann das gelingen?
Vielleicht sollten wir in Zukunft die Sozial-, Human- und Geisteswissenschaften stärker einbeziehen, zumindest punktuell. Wie hilfreich das sein kann, erlebe ich gerade bei der Leopoldina, wo ich in einer Fokusgruppe zu Klima und Energie mitarbeite. Wir Natur- und Technikwissenschaftler in der Gruppe profitieren sehr vom Fachwissen der ebenfalls beteiligten Ökonomen. Sie helfen uns, Geschäftsmodelle für unsere schönen Ideen zu entwickeln. Denn was sich nicht rechnet, kann man vergessen – das ist eine wichtige Erkenntnis, die ich in vielen Berufsjahren gewonnen habe. Wirtschaftswissenschaftliche Expertise beispielsweise könnte auch die GDNÄ bereichern, etwa bei einzelnen Themen in den Versammlungen. Ihren Charakter als naturwissenschaftliche Gesellschaft würde sie dennoch behalten.

© Frank Vinken für MPI für Kohleforschung
Die Professoren Alois Fürstner, Frank Neese, Tobias Ritter, Benjamin List und Ferdi Schüth (v.l.n.r.) bilden zusammen das Direktorium des Mülheimer Max-Planck-Instituts.
Eine naturwissenschaftliche Gesellschaft, die im Dialog mit der Öffentlichkeit steht…
…ja, und das ist eine Stärke der GDNÄ, die wir noch weiter ausbauen können. Der Kommunikationsbedarf ist groß, denn einerseits ist Wissenschaft wichtiger denn je, andererseits vertraut die Gesellschaft ihr weniger als noch vor 20, 30 Jahren. Heute gibt es alternative Fakten und Querdenker, mit denen ein vernünftiges Gespräch kaum möglich ist. Wir als Wissenschaftler müssen unsere Arbeit stärker rechtfertigen als früher und genauer erklären, was Wissenschaft kann und was sie nicht kann. Dafür ist die GDNÄ eine sehr gute Plattform.
In der öffentlichen Diskussion dominieren aktuell die politischen Themen. Dabei geht es auch um das wissenschaftsfeindliche Verhalten der Trump-Regierung. Sollte Deutschland die Chance nutzen, wie es einige vorschlagen, und US-Wissenschaftler gezielt abwerben?
Wir sollten Aufnahmebereitschaft signalisieren und Optionen in Deutschland aufzeigen. Offensiv darauf hinzuarbeiten, dass amerikanische Wissenschaftler ihr Land verlassen, halte ich nicht für den richtigen Weg.
Wirkt sich die aktuelle US-Politik auf Ihr Institut aus?
Ja, die Folgen sind spürbar. Jahrzehntelang konnten wir unsere Postdocs problemlos für ein paar Forschungsjahre in die USA schicken. Das ist derzeit schwierig, weil viele US-Forschungseinrichtungen verunsichert sind und nicht wissen, was morgen kommt. Meldet Euch in ein paar Monaten nochmal, heißt es jetzt oft auf unsere Anfragen.

© Frank Vinken / MPG
Der Mahlprozess in einer Kugelmühle aktiviert einen Katalysator so, dass er die Synthese von Ammoniak bei viel niedrigerer Temperatur und geringerem Druck vermittelt, als sie im etablierten Haber-Bosch-Verfahren nötig sind.
In Ihrer aktuellen Forschungsarbeit geht es um die Energie von morgen. In diesem Zusammenhang ist auch die Mechanokatalyse zu sehen, für deren Erforschung Sie im vergangenen Jahr einen mit 2,5 Millionen Euro dotierten Advanced Grant des Europäischen Forschungsrats ERC einwerben konnten. Was haben Sie nun vor?
Wir möchten grundlegende Abläufe in der Mechanochemie auf molekularer Ebene verstehen. Unsere mechanochemischen Reaktionen führen wir in Kugelmühlen durch. Da laufen Reaktionen bei Raumtemperatur und normalem Druck ab, für die sonst mehrere hundert Grad und hundert bar Druck erforderlich sind. Das spart Ressourcen, Zeit und Kosten. Meine Arbeitsgruppe hat mit diesem Konzept bereits spannende Projekte realisiert, beispielsweise die Synthese von Ammoniak. Ein Detailverständnis des Prozesses könnte die Produktion völlig neuer Materialien ermöglichen. Das ist aber nicht Teil des ERC-Projekts, beim Aufklären der Prozesse handelt es zunächst um reine Grundlagenforschung. Dennoch wird in meiner Abteilung, basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen, zur Zeit die Gründung mehrerer Start-up-Unternehmen vorbereitet.
Lassen Sie uns noch einen Blick auf Ihren Werdegang werfen: Sie haben Chemie und Jura studiert, eine ungewöhnliche Fächerkombination. Wie kam es dazu?
Die meisten Chemiker gehen nach dem Studium in die Industrie und so dachte ich mir, ein zusätzliches Jurastudium sei nicht verkehrt. Juristen denken anders, das hat mich interessiert. Als ich dann drei Mal durch die erste Prüfung gefallen bin, hat mich der Ärger gepackt und ich wollte beweisen, dass ich es kann. Ärger ist ein guter Antrieb. Meine Laufbahn hat sich dann anders entwickelt, aber die Jurakenntnisse haben mir später bei der Gründung unserer Firma hte geholfen.
Sie feiern in diesem Jahr Ihren 65. Geburtstag. Für viele Berufstätige ist das ein Wendepunkt im Leben. Wie ist es für Sie?
Ich habe vor, in dem für Max-Planck-Direktoren ohne größere Hürden möglichen Renteneintrittsalter von 68 Jahren aufzuhören. Das wäre dann knapp zwei Jahre später als das reguläre Pensionierungsalter. Bis dahin, wir sprechen von 2028, sollten die Promotionsvorhaben in meinem Bereich abgeschlossen sein, bis dahin läuft auch – für mich mit einigen Monaten am Emeritusarbeitsplatz – das ERC-Projekt. Ich freue mich auf die neuen Freiheiten als Pensionär. Ich werde Bücher schreiben, als Erstes vielleicht ein Buch über Energie. Und ich will Deutschland durchwandern: einmal längs von Nord nach Süd.

© Robert Eickelpoth
Prof. Dr. Ferdi Schüth
Zur Person
Ferdi Schüth, Jahrgang 1960, studierte Chemie und Jura an der Universität Münster und wurde 1988 in Chemie promoviert. Nach einem Postdoc-Aufenthalt an der Universität von Minnesota habilitierte er sich in Anorganischer Chemie in Mainz. 1995 wurde er Professor an der Universität Frankfurt. 1998 zog es ihn nach Mülheim an der Ruhr, wo er Direktor am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung wurde. Seit 1999 ist er auch Honorarprofessor an der Ruhr-Universität Bochum. Im selben Jahr gründete er mit sechs Kollegen die hte GmbH. Deren Geschäftsmodell basiert auf einem Verfahren, mit dem sich optimale Katalysatoren für chemische Reaktionen schnell und effizient finden lassen. Insgesamt geht es in Schüths Forschung um Katalyse, Zeolithe, poröse Materialien und energiebezogene Themen.
Ferdi Schüth hatte und hat zahlreiche Funktionen in wissenschaftlichen Gesellschaften und Gremien inne. So war er unter anderem von 2014 bis 2020 Vizepräsident der Max-Planck-Gesellschaft mit Zuständigkeit für die Fachgebiete Chemie, Physik und Technik. Er hat viele Auszeichnungen für seine wissenschaftliche Arbeit erhalten, darunter den Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Als Mitglied der Leopoldina leitet er, zusammen mit Robert Schlögl, die Fokusgruppe „Klima und Energie“.
>> hte GmbH