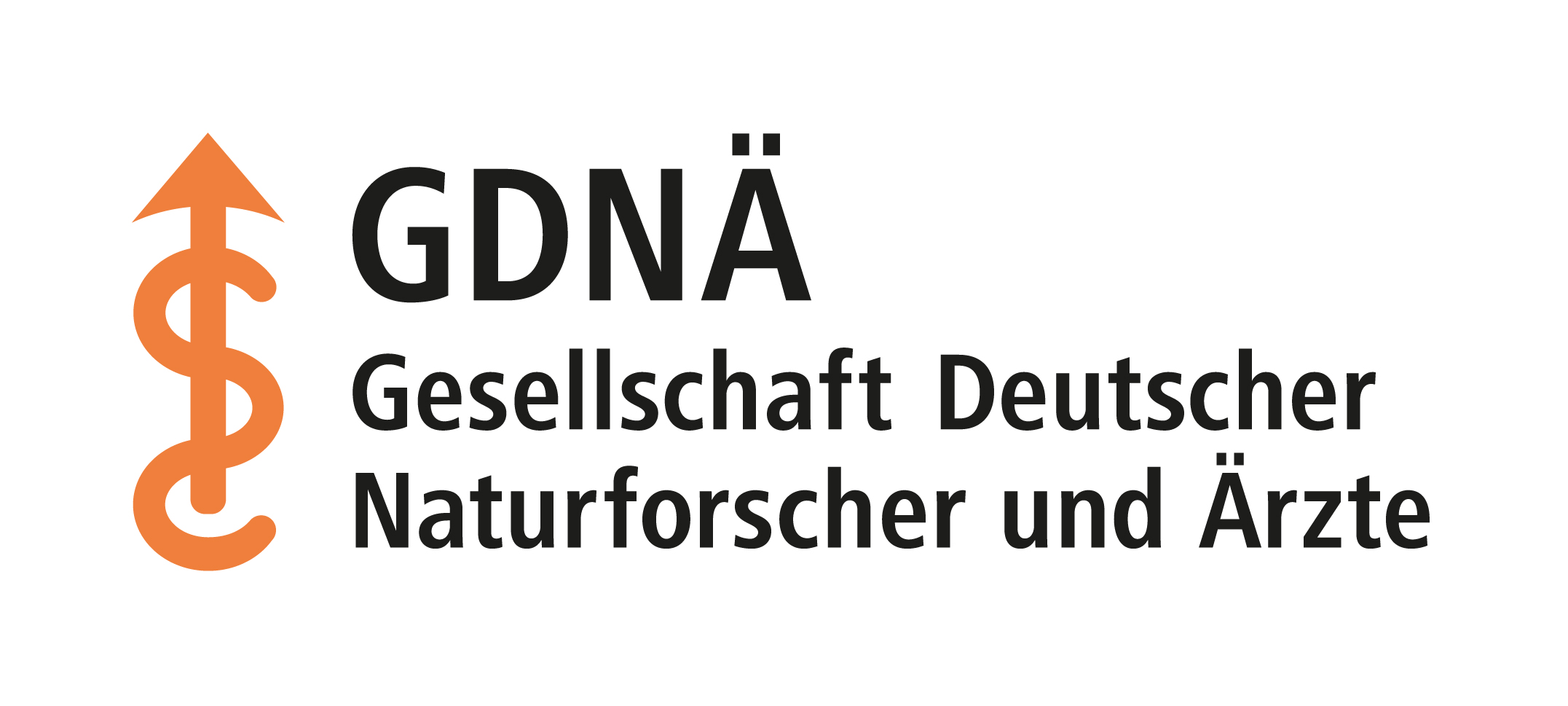„Ohne Industriekontakte geht es in meinem Fach nicht“
Herr Professor Bolm, Sie haben sich früh für die Chemie entschieden, sind Hochschullehrer geworden und dabei geblieben – inzwischen seit gut dreißig Jahren. Würden Sie diesen Weg noch einmal gehen?
Ja, für mich ist er immer genau richtig gewesen. Ich kann meine Forschung nach eigenem Ermessen gestalten und talentierte junge Leute in ihrer Entwicklung begleiten: Diese Vorzüge genieße ich Tag für Tag. Es ist kein Nine-to-five-Job, man ist immer gefordert und gelegentlich findet mein Team, dass ich zu hart arbeite. Es gibt diesen Trend beim Nachwuchs, der Universität den Rücken zu kehren und sich einen ruhigeren Job zu suchen. Da versuche ich gegenzusteuern, unter anderem mit meinem Vortrag „Warum Sie an der Hochschule bleiben sollten“. Ich werde ihn demnächst wieder halten.
Was sind Ihre Hauptargumente für die Hochschullaufbahn?
Die gedankliche Freiheit und die Möglichkeit dem nachzugehen, was man beruflich am liebsten tut.
Wodurch wurde Ihre Begeisterung für die Forschung und speziell für die Chemie geweckt?
Rollenmodelle in der Familie gab es nicht. Aber meine Eltern haben mir Chemiebaukästen geschenkt und ich durfte in einer nahegelegenen Apotheke alle Chemikalien kaufen, die ich für meine Experimente brauchte. Heute ginge das nicht mehr, es wäre den Erwachsenen zu riskant, aber in den Sechziger- und Siebzigerjahren war das kein Problem. Viel zu verdanken habe ich meiner Biologielehrerin. Sie promovierte nebenher im Fach Mikrobiologie und unterrichtete Biologie mit einer starken Chemieorientierung. Ihre Begeisterung war ansteckend und irgendwann war mir klar: Ich werde Chemiker.

© Carsten Bolm
Die große, international gemischte Arbeitsgruppe von Carsten Bolm vor dem Institutsgebäude.
Diesen Plan haben Sie, so scheint es, zielstrebig umgesetzt.
Von außen wirkt das vielleicht so. Ich selbst empfand mich in der Zeit als ziemlich sprunghaft. Acht Umzüge, in Deutschland, der Schweiz, in den USA, und nirgendwo war ich länger als zwei Jahre. Dass daraus eine akademische Laufbahn wurde, hat viel mit dem Glück zu tun, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute zu treffen.
Sie sprachen von der Faszination der Chemie. Was genau fasziniert Sie?
Die Chemie erfordert sowohl Kopf- als auch Handarbeit, eine wunderbare Kombination. Sie ist auch die einzige Disziplin, in der ständig neue Stoffe herstellt werden – Substanzen, die es vorher nicht gab. Das begeistert mich immer wieder aufs Neue.
Sie sind Organischer Chemiker, betreiben aber auch Mechanochemie. Wie passt das zusammen?
Zu Beginn einer akademischen Karriere muss man sich auf wenige Forschungsfragen spezialisieren, um Profil und Sichtbarkeit in der Fachwelt zu gewinnen. Später habe ich mein Spektrum Zug um Zug erweitert, unter anderem in Richtung Mechanochemie. Anwendung findet sie häufig in den Geowissenschaften, wenn es etwa darum geht, Stoffe mithilfe einer Kugelmühle energieeffizient und lösungsmittelfrei zu zerkleinern. Vor zwanzig Jahren war das in der organischen Synthesechemie noch Neuland, heute wird die Mechanochemie als maßgebliche methodische Weiterentwicklung angesehen. In meiner Arbeitsgruppe nutzen wir das Verfahren, um einerseits bestehende Syntheseverfahren zu verbessern und andererseits chemisches Neuland zu entdecken – die ungewöhnlichen Reaktionsbedingungen in den Kugelmühlen sind für manche Überraschung gut.

© Carsten Bolm
Wie entstehen solche neuen Ansätze an Ihrem Institut?
Oft durch fachübergreifenden Austausch. Bei der Suche nach neuen Wirkstoffen gegen Krankheiten arbeite ich zum Beispiel viel mit Medizinern zusammen. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Schwefelchemie, etwa zur Entwicklung neuer Tuberkulose-Hemmstoffe. Dank interdisziplinärer Kooperation konnten wir die Substratpalette der Sulfoximine, die sich insbesondere für die Nutzung in der Medizinalchemie und im Pflanzenschutz eignen, maßgeblich erweitern. Kooperationen gibt es auch mit Ingenieuren, etwa im kürzlich wieder bestätigten RWTH-Exzellenzcluster Integrated Fuel & Chemical Science Center, kurz: FSC2. Hier unterstützen wir die Entwicklung umweltfreundlicher flüssiger Energieträger. Ob an der eigenen Universität oder im Rahmen großer EU-Projekte: Wir setzen stets auf hochkarätige, verlässliche Partner. Und das bekommt uns sehr gut.
Welche Rolle spielt bei Ihnen der Kontakt zur Industrie?
Eine ganz wichtige. Ich würde sogar sagen: Ohne Industriekontakte geht es in meinem Fach nicht. Meine Arbeitsgruppe hat zum Beispiel enge Kontakte zur Pharmaindustrie, um gemeinsam neue Wirkstoffe zu entwickeln. Eine Pflanzenschutzfirma testet derzeit eine in unseren Laboratorien entdeckte neue Verbindungsklasse. Und ebenso wie viele andere Chemieinstitute an deutschen Hochschulen profitieren wir wesentlich vom Fonds der Chemischen Industrie bei der Förderung des akademischen Nachwuchses. Er vergibt Preise und Fördermittel – für unsere jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist das sehr wichtig.

© Stefanie Zimmer
Lernort Labor: Postdoktorand Dr. Renè Hommelsheim (rechts) beantwortet die Fragen des Master-Studenten Christian Keisers zur Schwefelchemie.
Wie geht es dem Chemiestandort Deutschland aus Ihrer Perspektive?
Wir sehen mit Sorge, dass die großen Chemieunternehmen immer weniger Stellen für unsere Absolventinnen und Absolventen anbieten. Aber wer lange genug sucht, findet etwas – das gilt vor allem für promovierte Chemikerinnen und Chemiker. Oft handelt es sich um Positionen in kleineren Firmen. Insgesamt leidet die Branche unter den gewaltigen Energiekosten und viele Unternehmen erwägen derzeit eine Verlagerung ins Ausland. Hilfreich wäre eine schnelle politische Intervention zur Kostensenkung.
Vor fast 30 Jahren haben Sie den Ruf auf einen Lehrstuhl an der RWTH angenommen und sind trotz anderer Angebote geblieben. Was hat Sie in Aachen gehalten?
Der starke Standort, gute Forschungsbedingungen und die hohe Lebensqualität. Ich komme aus Braunschweig, habe mich in Basel habilitiert und träumte von einem Leben im deutschen Südwesten. Aber es verschlug mich nach Aachen. Sollte ein Angebot aus Freiburg kommen, dachte ich damals, dann unterschreibe ich blind. Etwas später kam er wirklich, der Ruf aus Freiburg. Die RWTH machte ein so großzügiges Gegenangebot, dass ich nicht Nein sagen konnte. Es folgte ein weiterer Ruf – aber erneut war die RWTH besser. Und mit der Zeit habe ich die Stadt, die Nähe zu Belgien und das Rheinland sehr schätzen gelernt.
Wie sind Sie zur GDNÄ gekommen?
Durch einen Telefonanruf vor anderthalb Jahren. Michael Dröscher, Chemiker wie ich und langjähriger Generalsekretär der GDNÄ, fragte mich, ob ich Lust auf eine Mitarbeit hätte. Die GDNÄ war mir damals zwar bekannt, doch mir fehlte ein klares Bild von ihren Zielen. Ich glaube, es geht vielen an den Hochschulen so. Ich bin dann zur Versammlung in Potsdam gereist und fand sie extrem gelungen. Beeindruckt hat mich das Zusammenwirken der Disziplinen und das wertschätzende Miteinander von Jung und Alt – in dieser Art und Ausprägung hatte ich das noch nie erlebt. In Potsdam wurde das Junge Netzwerk der GDNÄ gegründet, das sich seither prächtig entwickelt. Da kommen einem gleich ganz neue Ideen.
Welche zum Beispiel?
Vielleicht gelingt es uns, in Aachen eine Vortragsserie zu Themen der modernen Chemie auf die Beine zu stellen, zusammen mit Vertretern der jGDNÄ. Wenn das klappt, könnte das auch ein Format für andere Universitätsstädte sein. Eine weitere Idee wäre es, GNDÄ-Mitglieder auf Vortragsreise an deutsche Hochschulen zu senden, um so die Gesellschaft mitsamt der jGDNÄ ins universitäre Rampenlicht zu rücken.
Sie wurden zum Fachvertreter für Chemie in den Vorstandsrat der GDNÄ gewählt. Was wollen Sie aus dem Amt machen?
Zu meinen zentralen Aufgaben gehört es derzeit, hochkarätige Chemiker für möglichst allgemeinverständliche Vorträge über ihre Forschung für die Versammlung 2026 in Bremen zu gewinnen. Die Themen sollen aktuell und von fachübergreifendem Interesse sein. Es ist ein wunderbares Amt und es passt perfekt zu meinem Anliegen: Ich will die Chemie sichtbarer machen – in Wissenschaft und Öffentlichkeit – und die GDNÄ gleich mit.

© Martin Braun Fotografie
Prof. Dr. Carsten Bolm, Lehrstuhl für Organische Chemie II an der RWTH Aachen University.
Zur Person
Professor Carsten Bolm (65) ist geschäftsführender Direktor des Instituts für Organische Chemie der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen University. Seine Forschungsbeiträge reichen von der Grundlagenforschung im Bereich der organischen Synthesechemie über die Mechanochemie bis zur Entwicklung neuer biobasierter Kraftstoffe.
Carsten Bolm wuchs in Braunschweig auf und studierte dort und an der University of Madison, Wisconsin, Chemie. 1987 wurde er in Marburg promoviert und absolvierte anschließend einen Postdoc-Aufenthalt beim zweimaligen Nobelpreisträger Barry Sharpless am Massachusetts Institute of Technology in Boston. 1993 habilitierte er sich an der Universität in Basel. 1996 nahm er einen Ruf auf einen Lehrstuhl für Organische Chemie der RWTH an. Der Chemiker gehörte mehrfach zu den „Thomson Reuters Highly Cited Researchers“ und wurde 2015 zum Fellow der britischen Royal Society of Chemistry ernannt. Im Jahr 2022 wurde er in die Academia Europaea berufen. Die Gesellschaft Deutscher Chemiker verlieh ihm für seine Arbeit auf dem Gebiet der Katalyseforschung die Adolf-von-Baeyer-Denkmünze. Als Fachvertreter Chemie engagiert sich Professor Bolm seit 2024 im GDNÄ-Vorstandsrat.

© Carsten Bolm
Das RWTH-Institut für Organische Chemie. Das Relief über dem Eingang zeigt die Entwicklung der Chemie im Verlauf der Jahrhunderte. Dargestellt ist auch der nicht metallische Feststoff Schwefel, den die Arbeitsgruppe Bolm neu beforscht. Schwefel war schon im Mittelalter ein Grundstoff war.
Zum Weiterlesen