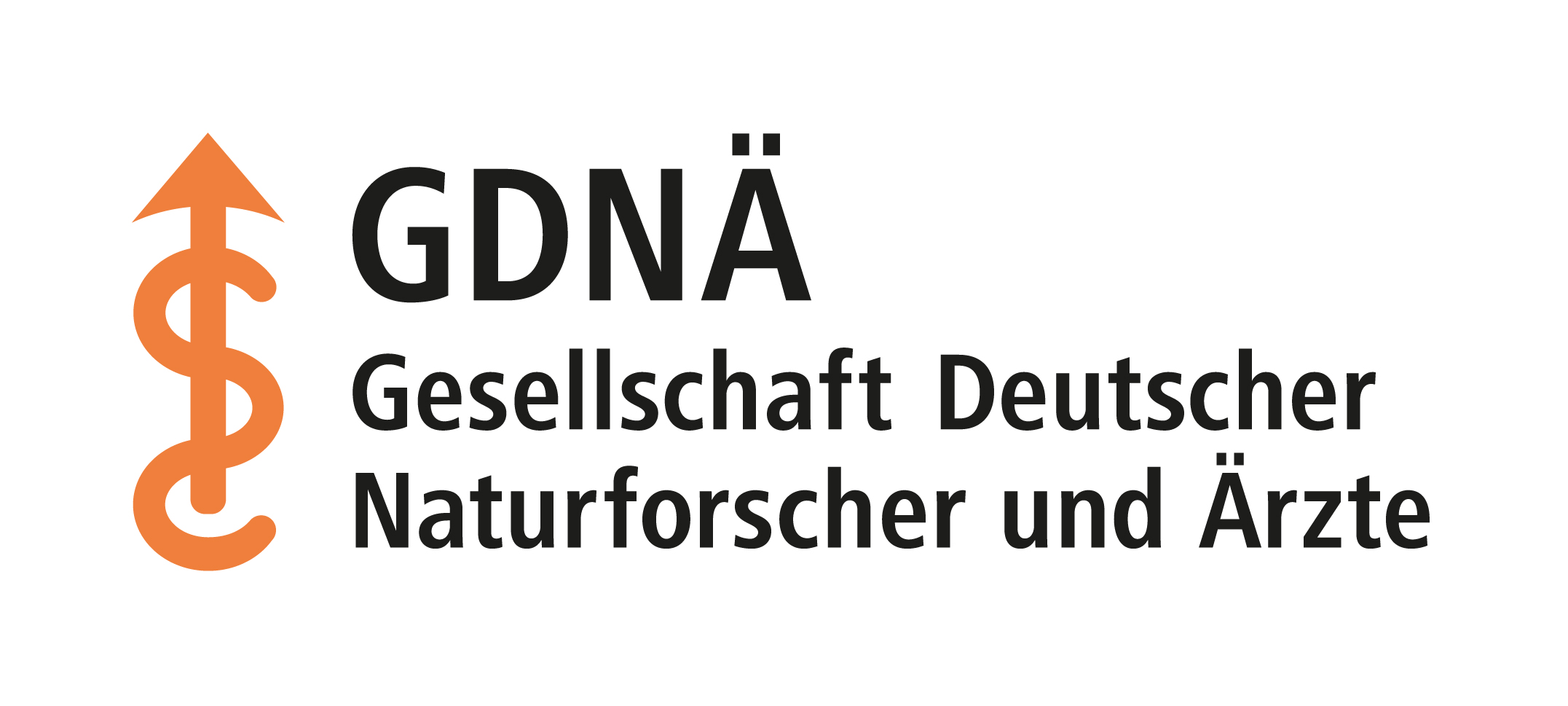„Diese Entwicklung dürfen wir nicht verschlafen“
Herr Professor Buchholz, Mitglied der GDNÄ sind Sie schon lange. Wie lange genau?
Tatsächlich schon seit mehr als einem Vierteljahrhundert. Dazu gebracht hat mich Professor Heribert Offermanns, ein begnadeter Chemiker und Vorstandsmitglied der Degussa. Als Vorstandsassistent habe ich einige Jahre für ihn gearbeitet und zum Beispiel Reden für ihn geschrieben. Herr Offermanns war mein Mentor – er hat mich von den Qualitäten der GDNÄ überzeugt.
Was hat Sie besonders angesprochen?
Das große Themenspektrum und der fachübergreifende Ansatz in den Naturwissenschaften. Schon als Kind habe ich mich für die Natur in ihrer ganzen Fülle interessiert und war fasziniert von der Unendlichkeit des Weltalls. Als es dann ans Studieren ging, fiel es mir schwer, mich zwischen Chemie, Biologie und Physik zu entscheiden. Die Wahl fiel schließlich auf die Chemie, was im Nachhinein betrachtet richtig für mich war.
Inwiefern?
Weil die Chemie sehr viele Anknüpfungspunkte zu anderen Disziplinen bietet. Die spannendste Zeit meiner beruflichen Laufbahn waren die Jahre im Bereich Biotechnologie, in denen ich unter anderem mit Biologen, Physikern und Ingenieurwissenschaftlern zusammenarbeiten konnte. Das waren wunderbare interdisziplinäre Teams, die zu tollen Ergebnissen kamen. Ich denke zum Beispiel an fermentativ erzeugte Aminosäuren, die aus tierischem Material gewonnene Aminosäuren ersetzen. In der BSE-Krise war das eine wichtige und für das Unternehmen gewinnbringende Neuerung.

© Evonik
Sie haben bei der damaligen Degussa angefangen und sind dem Unternehmen und seinen Nachfolgefirmen, heute Evonik, bis zum Ruhestand treu geblieben. Eine akademische Karriere hat Sie nicht gereizt?
Doch, grundsätzlich schon, die war ursprünglich mein Ziel gewesen, aber die Chemie war nach meiner Einschätzung, die ich im Studium gewonnen habe, relativ ausgeforscht, die grundlegenden Moleküle sind bekannt. Klar, man kann noch unendlich viele neue Moleküle herstellen, aber das war nicht mein Weg. Mehr interessierten mich dann die Innovation, die Nutzung von Wissen für neue Prozesse und Produkte. Spannend fand ich auch den Praxistransfer vom Forschungsergebnis in die großtechnische Produktion. Das ist schwierig, aber immer wieder gelingt er auch. Ein Beispiel sind die sehr hautfreundlichen, naturidentischen und biologisch abbaubaren Biosurfactants, die eines meiner Projektteams im letzten Jarhzehnt entwickelt hat: Heute werden sie etwa in Spülmitteln und Hautpflegeprodukten verwendet. Als Biotech-Verantwortlicher, der über mehrere Jahre nur Biologen und Ingenieuren als Mitarbeiter hatte, fühlte ich mich in der chemischen Industrie sehr wohl.
Der deutschen Chemieindustrie geht es derzeit nicht gut. Fehlt es an Innovation?
Ja, aber nicht nur im Sinne von neuen chemischen Produkten. Wir haben schon sehr viele gute Produkte. Die chemische Industrie ist eine reife Industrie, die in einer gigantischen Transformation steckt. Energie und Rohstoffe sind teuer, Billigkonkurrenz und schwache Nachfrage drücken die Margen. Eine Konsolidierung ist unausweichlich, die chemische Industrie wird schrumpfen. Gleichzeitig wird sie dringend gebraucht, auch um dem Klimawandel zu begegnen und die Umwelt besser zu schützen. Gefragt sind jedoch radikal neue Ansätze. Chancen sehe ich in der Verknüpfung von Chemie und künstlicher Intelligenz, sie wird dem Fach einen großen Schub geben. Und diese Entwicklung dürfen wir nicht verschlafen.

© Evonik
Das klingt nach einem guten Thema für die nächste GDNÄ-Versammlung 2026 in Bremen.
Ja, tatsächlich ist dazu ein Beitrag vorgesehen. Geplant sind auch Vorträge zur industriellen Biotechnologie und zur elektrokatalytischen Gewinnung von grünem Wasserstoff. Den Nobelvortrag wird Benjamin List vom Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim halten. Er berichtet von seiner Forschung zur Organokatalyse, für die er 2021 den Chemie-Nobelpreis erhielt.
In der GDNÄ sind Sie nicht nur Gruppenvorsitzender für das Fach Chemie, sondern auch designierter Generalsekretär. Anfang 2027 werden Sie das Ehrenamt von Michael Dröscher übernehmen. Was motiviert Sie?
Die GDNÄ passt gut zu mir und meinem Interesse an grundsätzlichen und zugleich fachübergreifenden Fragen. Dafür steht die GDNÄ seit zweihundert Jahren. Das beeindruckt mich, das finde ich wichtig und gern trage ich zu ihrer künftigen Entwicklung bei.
Haben Sie dafür schon Ideen?
In meinem Studium an der Universität des 3. Lebensalters der Frankfurter Goethe-Universität. beschäftige ich mich derzeit intensiv mit Naturphilosophie. Dabei geht es auch um unsere Fähigkeit zur Naturerkenntnis und deren Grenzen. Wir lernen viel über Wissenschaftstheorien und Wissenschaftsgeschichte und diskutieren angeregt darüber. So ein Themenangebot könnte ich mir auch in der GDNÄ vorstellen. Dass Interesse an derart grundsätzlichen Fragen besteht, zeigt der große Zulauf zu meinem Studiengang.

© Privat
Prof. Dr. Stefan Buchholz, Chemiker, designierter Generalsekretär der GDNÄ.
Zur Person
Professor Stefan Buchholz studierte in Marburg Chemie und absolvierte am Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz mit einer Arbeit über monomolekulare Schichten seine Promotion. Anschließend ging Buchholz als Post-doc an die Harvard University in Boston. Seit 2011 ist er Honorarprofessor an der Universität Stuttgart. Seine berufliche Laufbahn begann der 63-Jährige bei der Degussa 1993 im Geschäftsbereich Industrie- und Feinchemikalien in Frankfurt. In den Jahren 1995 bis 1998 leitete er die Forschungsplanung und -koordination des Unternehmens und war Vorstandsassistent. Von 1998 bis 2000 arbeitete der Chemiker als Betriebsassistent am Degussa-Standort Antwerpen. 2000 übernahm er die Leitung des Projekthauses Biotechnologie, einer Forschungsgruppe, die sich schwerpunktmäßig mit Biokatalyse beschäftigte. Anschließend war Stefan Buchholz unter anderem vier Jahre lange Leiter des Bereichs Innovation Management C4 Chemie, bevor er im Jahr 2012 die Leitung der strategischen Forschungs- und Entwicklungseinheit Creavis und später die der Division Nutrition and Care übernahm. Im Jahr 2023 wechselte er in den Vorruhestand. Professor Buchholz wurde mehrfach ausgezeichnet; zuletzt erhielt er den Degussa Innovations-Preis für die Entwicklung neuer Fermentationsprozesse in der Pharmaproduktion. Er war und ist Mitglied in zahlreichen Gremien und Fachgesellschaften, hat vielfach publiziert und besitzt mehr als zwanzig Patente.