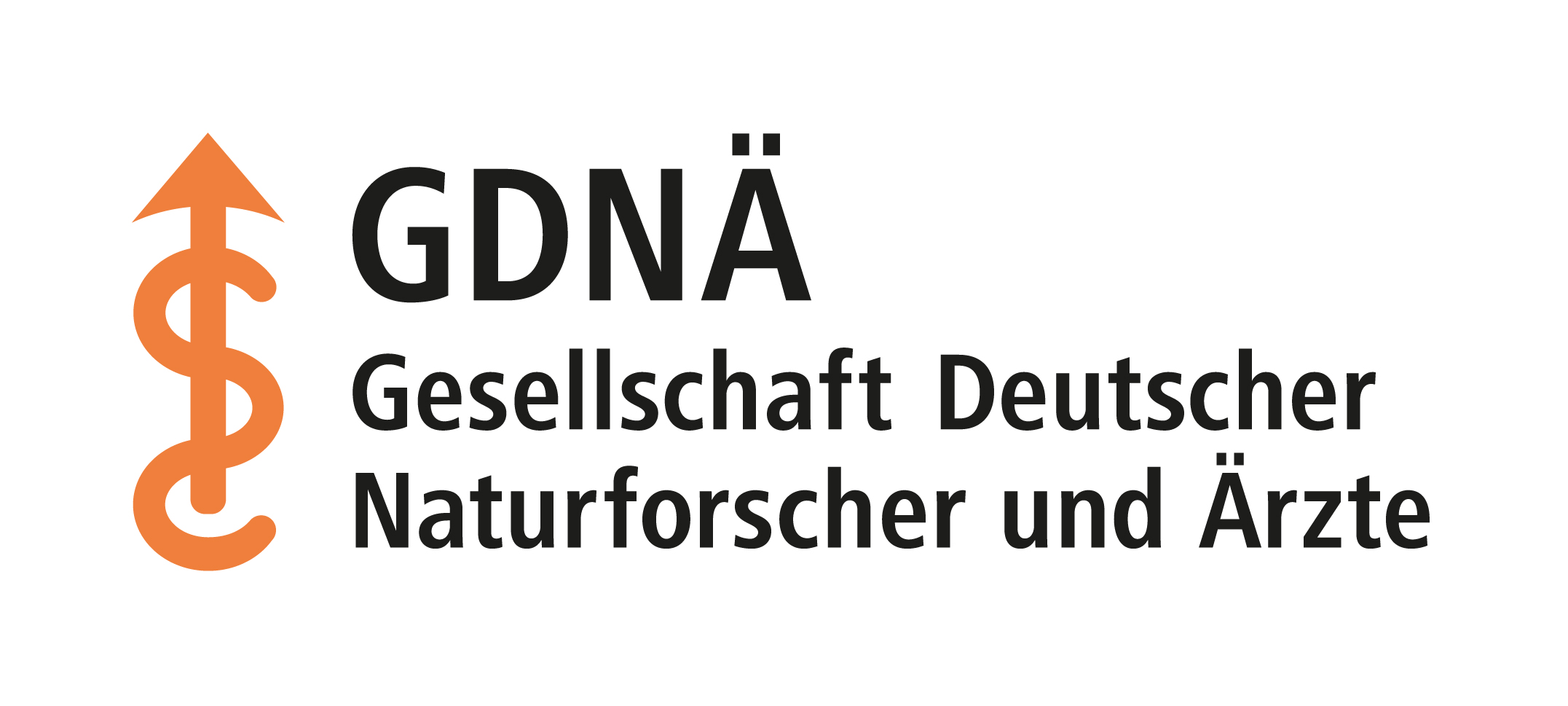„Nachwuchsgewinnung auf Platz eins“
Frau Professorin Kaysser-Pyzalla, das Motto der 133. Versammlung der GDNÄ war „Wissenschaft für unser Leben von morgen“. In welchen Bereichen sehen Sie hier die größten Herausforderungen und Chancen für die Wissenschaft?
Unser Leben von morgen wird bestimmt durch die gesellschaftlichen Entwicklungen. Die größte Herausforderung für die Wissenschaft ist es, ihre eigene Relevanz für die Gesellschaft verständlich darzustellen. Auch wir als GDNÄ müssen zeigen, welchen Anteil die Forschung an der Zukunft der Gesellschaft und ihrer wirtschaftlich-technologischen Grundlagen hat. Die größte Chance für die Wissenschaft besteht darin, ihre Ergebnisse und Methoden, aber auch ihre Grenzen zu kommunizieren. Zu sagen: „Wir sind für die Gesellschaft da“. Unsere Aufgabe ist es, Wissenschaft erkennbar zu machen, in dem was sie hervorbringt. Forschung ist damit eine der Grundlagen für Entscheidungen in unserer Demokratie.
Nicht alle diese Aufgabengebiete sind für den wissenschaftlichen Nachwuchs in gleicher Weise attraktiv. Gibt es Bereiche, die Ihnen Sorgen machen?
Sorgen bereiten mir die geringen Studierendenzahlen in den technischen Fächern. Doch Potsdam hat gezeigt, dass der Nachwuchs die neuen Herausforderungen verstanden hat. Er setzt sich mit Fragestellungen auseinander, die sich mit aktuellen Entwicklungen oder historischen Fehlentwicklungen beschäftigen und eine hohe Relevanz für die Gesellschaft haben. Als GDNÄ müssen wir unserem Nachwuchs die Sinnhaftigkeit und Interdisziplinarität der Forschung für seine Entwicklung vermitteln. Die Fähigkeit zur Teamarbeit sowie eine klare Analyse- und Bewertungsfähigkeit sind zudem gute Voraussetzungen für Karrieren in der Forschung, die in die Wirtschaft führen und wieder zurück.

© Dima-Juschkow
Mit der Gründung des Jungen Netzwerks der GDNÄ sollen junge Menschen schon früh gezielt an wissenschaftliches Denken und Arbeiten herangeführt werden. Welchen Stellenwert hat die Jugendarbeit innerhalb der GDNÄ als Ganzes?
Die Nachwuchsgewinnung muss auf Platz eins stehen. Ohne befähigten, engagierten und motivierten Nachwuchs ist Deutschland nicht konkurrenzfähig. Es gibt viele Jugendliche, die von sehr guten Lehrerinnen und Lehrern für die Naturwissenschaften begeistert werden. Der Bereich Technik kommt aber oft viel zu kurz. Wir als GDNÄ müssen Vorbild sein – wissenschaftliche Werte repräsentieren, diese neu denken und den Nutzen für die Gesellschaft in Sinn erklären. Wie kann es uns gelingen, durch attraktive Angebote, junge Menschen an wissenschaftliches Denken und Arbeiten heranzuführen? Die GDNÄ gibt dem Nachwuchs die Chance, Netzwerke aufzubauen und neue Leute, vor allem aber auch neue Themen kennenzulernen.
Bei jungen Menschen scheint es keine Geschlechterdisparität im Interesse für die Wissenschaft zu geben, was ja auch bei der jGDNÄ zu sehen ist. Doch in den fortgeschrittenen akademischen und Industrie-Karrieren sinkt der Anteil der Frauen oft dramatisch. Ist dies eine „Altlast“, die sich durch bessere Nachwuchsförderung lösen lässt, oder sehen Sie hier strukturelle Probleme, die gelöst werden müssen?
Ich sehe hier immer noch strukturelle Probleme, ergo eine Altlast. Der Anteil von Studentinnen steigt stetig. Viele beenden erfolgreich ihr Studium, wählen teils eine wissenschaftliche Laufbahn. Doch wie ist es dann bestellt um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Diese Vereinbarkeit, die für Frauen wie auch für Männer gilt, muss im wissenschaftlichen Alltag ankommen, so dass sie die erwarteten Ergebnisse erbringt. Alle haben die gleichen Chancen. Und es zeigt sich, dass es funktionieren kann. Zunehmend sind es Frauen, die sich in Bereichen etablieren, in denen sie bisher unterrepräsentiert waren. Auch in der GDNÄ ist zu spüren, dass sich junge Kolleginnen stark in unsere Arbeit einbringen und engagieren.
Wissenschaft im 21. Jahrhundert ist in den meisten Fällen hochspezialisiert, Forscherinnen und Forscher sind oft auf sehr enge Interessengebiete fixiert. Doch die Herausforderungen für „unser Leben von morgen“ sind komplex. Welche Rolle sehen Sie hier für die GDNÄ, um den Austausch zwischen den Disziplinen zu stimulieren und interdisziplinäres Denken zu fördern?
Die Rolle der GDNÄ muss zunehmend die eines Taktgebers in der deutschen Wissenschaftslandschaft sein. Es muss uns gelingen, interdisziplinäres Denken zu stärken. Versetzen wir uns zum Beispiel in die Rolle einer Raumfahrtingenieurin. Aus ihrem Spezialgebiet, nehmen wir die Orbitalmechanik heraus, ist sie gezwungen, viele Aspekte einer komplexen Mission zu beachten. Dies kann ihr nur gelingen, wenn sie bereit ist, über die Grenzen ihres Fachgebiets hinaus zu denken und zu handeln. Sie muss kollektives Wissen bündeln und erweitern, neue Ideen fördern und zudem die Zusammenarbeit verbessern. Dies mit einem hohen Maß an Interdisziplinarität im Kontext mit komplexen Systemen. Dann hat sie, dann haben wir Erfolg.
So wichtig der Dialog innerhalb der Wissenschaften ist – mindestens ebenso wichtig ist der Dialog der Wissenschaft mit und in der Gesellschaft. Doch bei Themen wie Klimawandel oder der Pandemiebekämpfung hat sich gezeigt, dass dieser Dialog nicht immer funktioniert. Das aktuelle Beispiel in den USA, wo anti- und pseudowissenschaftliche Positionen die Politik zu dominieren scheinen, zeigt auf geradezu dramatische Weise, wie dadurch nicht nur der wissenschaftliche Fortschritt, sondern sogar der wissenschaftliche Status quo, also das bereits Erreichte, aufs Spiel gesetzt werden kann. Wie kann und muss die Wissenschaft im Allgemeinen und die GDNÄ im Besonderen darauf reagieren?
Die GDNÄ ist die Summe ihrer Mitglieder. Jedes Mitglied sollte sich in Gesprächen und Diskussionen klar für die Sache der Wissenschaft positionieren. Leider müssen wir in den Medien beobachten, wie sich auch prominente Personen daran beteiligen, pseudowissenschaftliche Thesen zu vertreten. Dem können wir durch unsere Auftritte in der Öffentlichkeit entgegenwirken. Die GDNÄ steht für Erklärbarkeit. Dazu gehört, das vorhandene Wissen zu übersetzen, für jeden verständlich und nachvollziehbar. So wie es der letzte Preisträger der Lorenz-Oken-Medaille, Armin Maiwald, viele Jahrzehnte erfolgreich getan hat. Damit stärkt die GDNÄ die Akzeptanz wissenschaftlicher Ergebnisse, wie etwa denen zum menschengemachten Klimawandel. Wir erklären die Unsicherheiten von wissenschaftlichen Ergebnissen und erklären, wozu Wissenschaft gut ist. Denn Wissenschaft entwickelt sich, ebenso wie die GDNÄ, immer weiter.

© DLR
Prof. Dr.-Ing. Anke Kaysser-Pyzalla, GDNÄ-Präsidentin 2025/2026 und Vorstandsvorsitzende des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR).
Leseempfehlung
Dieser Beitrag gibt ein Interview mit Professorin Anke Kaysser-Pyzalla wider, das Jürgen Schönstein, Chefredakteur der Naturwissenschaftlichen Rundschau, für das Heft 9/10 (2025) führte. Die Naturwissenschaftliche Rundschau ist seit vielen Jahren das Organ der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. Die aktuelle Oktober-Ausgabe dokumentiert die Fachvorträge der 133. Versammlung der GDNÄ 2024 in Potsdam:
Zur Person
Prof. Dr.-Ing. Anke Kaysser-Pyzalla hat in Bochum und Darmstadt Maschinenbau und Mechanik studiert. Sie wurde an der Ruhr-Universität Bochum promoviert und habilitierte sich dort. Nach Forschungstätigkeiten am Hahn-Meitner-Institut (HMI) und an der Technischen Universität Berlin forschte und lehrte sie von 2003 bis 2005 an der Technischen Universität Wien. 2005 wechselte sie als Wissenschaftliches Mitglied, Direktorin und Geschäftsführerin in die Leitung des Max-Planck-Instituts für Eisenforschung GmbH nach Düsseldorf. 2008 folgte die Berufung zur Wissenschaftlichen Geschäftsführerin der Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH, die unter ihrer Leitung aus der Fusion von HMI und der Berliner Elektronenspeicherring-Gesellschaft für Synchrotronstrahlung (BESSY) hervorging. 2017 wurde Anke Kaysser-Pyzalla Präsidentin der Technischen Universität Braunschweig; seit 2020 ist sie Vorstandsvorsitzende des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Zur Präsidentin der GDNÄ wurde sie für die Amtsjahre 2025 und 2026 gewählt.