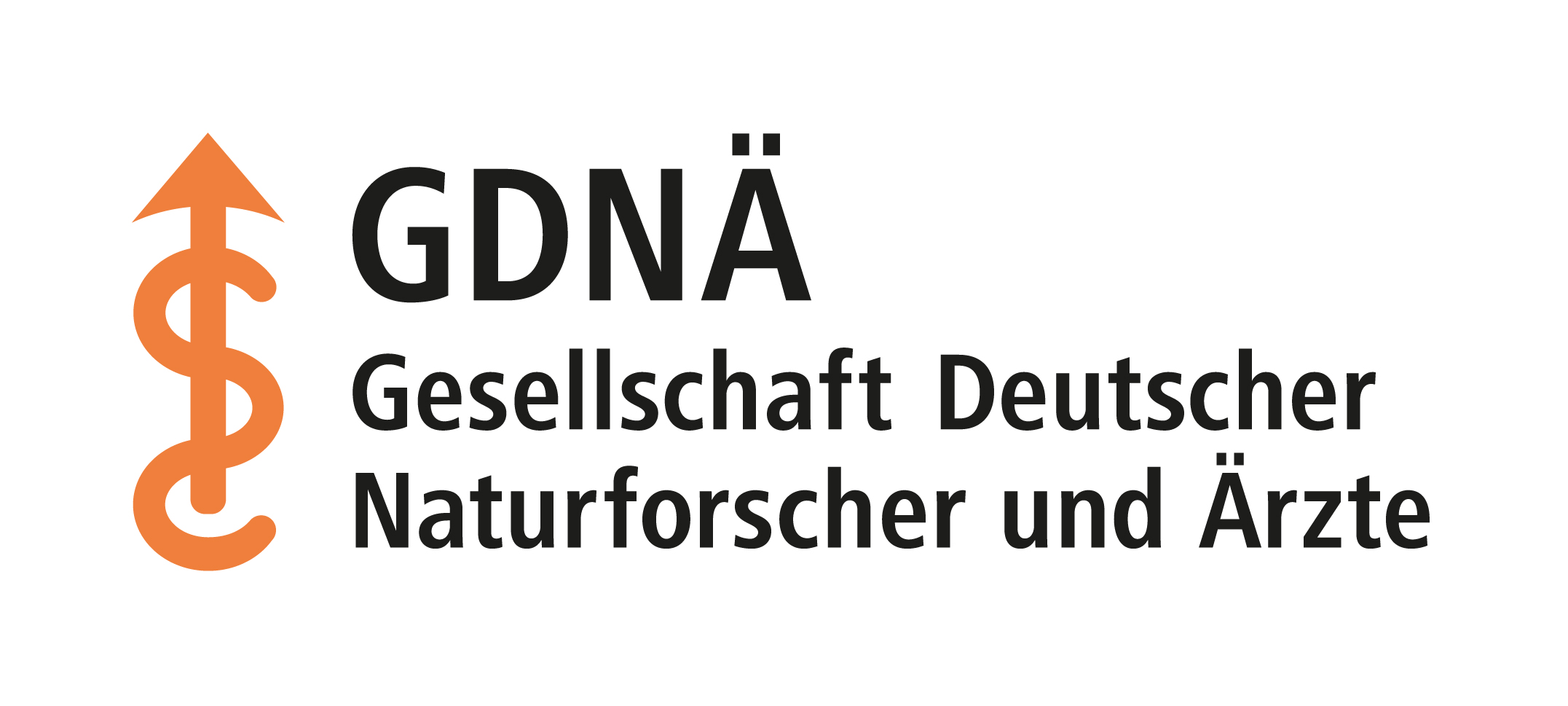„Willkommen in einer stolzen Wissenschaftsstadt“
Herr Professor Kucera, Sie haben das Amt des wissenschaftlichen Geschäftsführers für die GDNÄ-Versammlung 2026 in Bremen übernommen. Was hat Sie daran gereizt?
Ich kenne die GDNÄ aus meiner Zeit an der Universität Tübingen. An die von der Medizin-Nobelpreisträgerin und damaligen GDNÄ-Präsidentin Christiane Nüsslein-Volhard ausgerichtete Versammlung kann ich mich noch gut erinnern. Mit ihren fachübergreifenden Vorträgen und ihrem Schülerprogramm war die Tagung für mich ein Vorbild für moderne Wissenschaftskommunikation. Zur Wissenschaftsstadt Bremen, in der ich seit dreizehn Jahren arbeite, passt das alles sehr gut. Ich habe daher gern zugesagt, als mich die heutige Präsidentin der GDNÄ bat, die Aufgabe zu übernehmen.
Wie können wir uns Ihre Tätigkeit als wissenschaftlicher Geschäftsführer vorstellen?
Ich bereite der GDNÄ die Bühne vor Ort und unterstütze sie mit meinen Kontakten in der Bremer Wissenschafts-, Bildungs- und Kulturszene. Da geht es um die Gewinnung von Vortragenden, gute Adressen für das Begleitprogramm oder auch um Kontakte zu Schulen und zur Stadtverwaltung. Die Zeit und Kraft dafür investiere ich gern. Für uns ist die GDNÄ-Versammlung eine willkommene Gelegenheit, die Stärken des Wissenschaftsstandorts Bremen unter Beweis zu stellen.

© DHI Bremen
Welche Stärken sind das?
Der Stifterverband kürte Bremen im Jahr 2005 zur ersten deutschen „Stadt der Wissenschaft“. Das zeugt von der rasanten Entwicklung, die Hochschulen, Institute und die gesamte Wissenschaftsszene in Bremen und Bremerhaven in den letzten 50 Jahren gemacht haben. Ich selbst war immer von der großen Dichte an wissenschaftlichen Einrichtungen beeindruckt, die rund um unseren Campus im Technologiepark angesiedelt und miteinander stark vernetzt sind. Im Zentrum steht die Universität, drumherum scharen sich Hightech-Firmen und außeruniversitäre Institute. Die Wege sind kurz, gemeinsamer Treffpunkt ist oft die Mensa – das fördert Kooperationen. Mit unseren Schwerpunkten in der Meeresforschung, in künstlicher Intelligenz und Robotik, aber auch in den Sozialwissenschaften können wir international mithalten. Zudem ist Bremen eine tolle Stadt, die viel zu bieten hat. Die Menschen hier sind stolz darauf, in einer Stadt der Wissenschaft zu leben und sie kommen gern zu Vorträgen, Ausstellungen oder Diskussionsveranstaltungen. Die Bedeutung und der Nutzen von Wissenschaft für die Gesellschaft ist den Bremerinnen und Bremern bewusst.
Das passt zum Motto der Versammlung 2026: Wissen schafft Nutzen – Wissenschaft nutzen.
Ja, auch mit Blick auf die Anwendung von Forschung ist Bremen ein sehr geeigneter Tagungsort für die GDNÄ.
Als Konrektor für Forschung und Transfer an der Universität Bremen sind Sie zuständig für den Anwendungsbezug von Forschung. Wie gehen Sie vor?
Es ist mir wichtig, unsere Forschenden bei ihrem Engagement für Transfer zu unterstützen und unsere Wertschätzung für sie klar zu kommunizieren. Ich versuche zu verstehen, was Transfer fördert und was hinderlich wirkt. Dazu führe ich sehr viele Gespräche und versuche, Kolleginnen und Kollegen in der ganzen fachlichen Breite der Universität einzubinden. Wichtig ist uns auch, Kontakt zu lokalen Akteuren in Bremen zu pflegen, von der Kulturszene bis zu Wirtschaftsverbänden wie der Handelskammer und dem Industrieclub. Die enge Vernetzung ist der Schlüssel zum Erfolg für den Standort insgesamt.
Sie sind seit drei Jahren im Amt. Was hat sich beim Transfer getan?
Wir konnten einiges erreichen. Ein Beispiel ist der Digital Hub INDUSTRY, in dem wir zusammen mit kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Region maßgeschneiderte digitale Lösungen für die Industrie von Morgen entwickeln. Ein weiteres Beispiel ist das im Dezember 2024 gegründete Transferzentrum für nachhaltige Materialien, das matena innovate! center. Wir konnten uns in hartem Wettbewerb durchsetzen und die Hamburger Joachim Herz Stiftung für die Förderung unseres Standorts gewinnen. Hier entwickeln Forschungsteams der Universität und unserer Partnerinstitute neue Ansätze aus der Forschung bis zur Anwendungsreife. Im Fokus stehen Themen wie die stationäre Energiespeicherung für regenerative Energien, nachhaltige Futtermittel für die Aquakultur oder Sensormaterialien für die Wasserstoffwirtschaft. Zugute kommt uns eine veränderte Großwetterlage, wenn es um Transfer geht: Ihre Bedeutung wird gesellschaftlich zunehmend erkannt, ihr Image ist in den vergangenen Jahren deutlich besser geworden.

© Volker Diekamp, Universität Bremen
Sie sind Tscheche, haben in Prag studiert, in Schweden promoviert und Ihre wissenschaftliche Laufbahn führte sie über die USA, Großbritannien an mehrere Universitäten in Deutschland. Wie beurteilen Sie die deutsche Wissenschaftsszene im internationalen Vergleich?
Die Freiheit der Forschung an deutschen Universitäten ist großartig. Sie müssen sich nicht durch Studiengebühren finanzieren und sind deshalb weniger kommerziell ausgerichtet als Hochschulen im angelsächsischen Raum. Dort hat die Lehre eine größere Bedeutung als in Deutschland, es gibt viele Tutorien für Studierende und die Gestaltung des Curriculums ist flexibler als in Deutschland. Während es hierzulande oft um das Einhalten von Regeln gilt, etwa bei der Lehrverpflichtung, wird in Großbritannien die Lehre bedarfsgerecht und flexibel im Kollektiv der Lehrenden verteilt. Große Pluspunkte für Deutschland sind wiederum die hervorragende Forschungsförderung und die weltweit einmalige Forschungsinfrastruktur. Sie machen das Land zu einer wissenschaftlichen Großmacht. Ich zum Beispiel profitiere sehr von Zugang zu exzellenten meereswissenschaftlichen Geräten und hochmodernen Forschungsschiffen.
Haben Sie noch Zeit für eigene Forschung?
Ja, aber leider nicht mehr so viel wie früher. Deshalb starte ich derzeit keine neuen Großprojekte, sondern konzentriere mich auf die Auswertung der Ergebnisse vergangener Expeditionen. Da sind zum Beispiel Proben aus einer Tiefseebohrung, die wir 2022 bei einer von mir geleiteten Expedition in der Baffin Bay gewonnen haben. Hier erwarten wir neue Erkenntnisse zum Abschmelzverhalten der grönländischen Eiskappe in der Vergangenheit, die wichtig für unsere Zukunft in einem wärmeren Erdklima sind. Bei dieser Ausfahrt haben wir auch Sedimentkerne in Südgrönland gewonnen, die wertvolle Informationen über das Klima der letzten zehntausend Jahre enthalten. Sie werden uns helfen zu verstehen, warum die Wikinger ihre Siedlungen auf Grönland im 15. Jahrhundert verließen, nachdem sie vierhundert Jahre dort gelebt hatten. Die Expedition MSM 111 mit dem Forschungsschiff Maria S. Merian fand übrigens im Rahmen des Exzellenzclusters der Universität Bremen „Der Ozeanboden – unerforschte Schnittstelle der Erde“ statt, dessen Fortsetzung kürzlich bewilligt wurde.
Lassen Sie uns noch einmal auf die die GDNÄ-Tagung 2026 schauen: Auf was können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon jetzt freuen?
Auf faszinierende Vorträge zu aktuellen Themen in den Naturwissenschaften und ein tolles Begleitprogramm. Geplant ist zum Beispiel ein Empfang im Bremer Übersee-Museum. Das Haus mit seiner europaweit einzigartigen Sammlung aus Natur-, Völker- und Handelskunde feiert 2026 seinen 130. Geburtstag. Ein weiteres Highlight ist der Besuch im Universum Bremen Das beliebte Wissenschaftscenter liegt direkt am Uni-Campus und lädt uns mit bei einer exklusiven Führung zum Mitmachen und Experimentieren ein.

© Jan Rathke / Universität Bremen
Prof. Dr. Michal Kucera, Konrektor der Universität Bremen und Geschäftsführer Wissenschaft der GDNÄ-Versammlung 2026 in Bremen.
Zur Person
Michal Kucera studierte Geologie in Prag und promovierte an der Universität Göteborg in Schweden. Es folgten Aufenthalte im kalifornischen Santa Barbara, in London und in Tübingen, ehe er 2012 nach Bremen an den Fachbereich Geowissenschaften und das MARUM – Zentrum für Marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen als Professor für Mikropaläontologie / Paläozeanographie wechselte. In seiner Forschung untersucht Michal Kucera den Einfluss des Klimawandels in der älteren und jüngeren Vergangenheit auf die marine Umwelt und deren Bewohner.
Neben seiner Rolle im Vorstand des Excellenzclusters „Der Ozeanboden – unerforschte Schnittstelle der Erde“ war er Sprecher des deutsch-kanadischen Graduiertenkollegs ArcTrain und Mitglied der Senatskommission für Erdsystemforschung der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Seit September 2022 ist er Konrektor für Forschung und Transfer der Universität Bremen. 2025 wurde er in das Amt des Präsidenten der Wittheit zu Bremen gewählt, einer traditionsreichen wissenschaftlichen Gesellschaft der Freien Hansestadt Bremen. Und seit 2024 ist Michal Kucera Mitglied der GDNÄ und Geschäftsführer Wissenschaft für die 134. Versammlung der Naturforschergesellschaft in Bremen 2026.

@ Raphael Morard